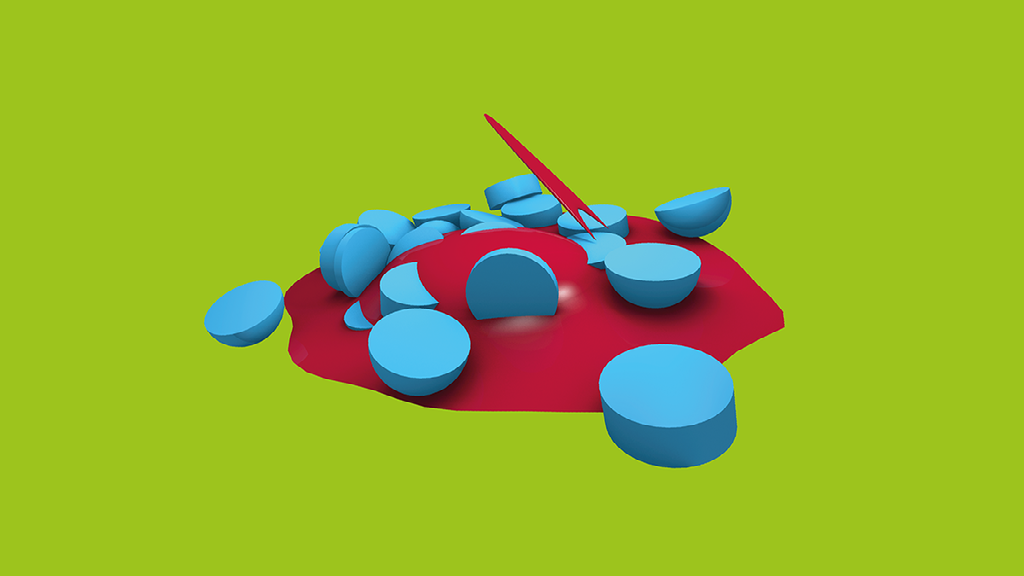Lea und Fiona verließen Berlin, um in Konstanz zu studieren. Ein Erfahrungsaustausch.
Ein Umzug von der Hauptstadt Berlin nach Konstanz – der Beginn des Abenteuers Baden-Württemberg – und das ist keineswegs ironisch gemeint. Auch innerhalb Deutschlands weisen Bereiche wie Sprache, Lebensstil, Mentalität, Umgebung und Kulinarik so eklatante Unterschiede auf, dass man bei einem Umzug von einem in das andere Bundesland berechtigterweise von einem Schock sprechen kann. In unserem Fall war dieser besonders groß, wurden wir ja sowohl dem Kontrast Ostdeutschland – Süddeutschland als auch Großstadt – ‚kleinere‘ Stadt ausgesetzt. Mittlerweile hat sich unsere Schockstarre gelöst. Wir fühlen uns bereit, über unsere Erfahrungen zu sprechen, und ja, wie es vielleicht bereits zwischen den Zeilen hindurch schimmert, ist auch ein gruppentherapeutischer Aspekt dieser Kollaboration nicht von der Hand zu weisen. Bei einer Portion Käsespätzle und einem Glas Müller-Thurgau tauschen wir uns aus, vergleichen Heimatgefühle und sprechen über das Ankommen.
Heimatgefühl und Alkohol als identitätsstiftende Größe
F: Unser Thema ist nach kurzem Smalltalk der Alkohol. So fand ich mich kurz vor meiner Abreise mit vollem Weinglas und Zigarette im Mundwinkel in meiner Berliner Stammkneipe wieder. Dem Skeptizismus, mit welchem meine Freunde meinem bevorstehenden Umzug begegneten, setzte ich glühenden Optimismus entgegen. Der Masterstudiengang „Literatur, Kunst, Medien“ hörte sich fantastisch an. Konstanz schien ein Ort zu sein, an dem man sich gut seinen Studien widmen kann. Stolz verkündete ich meinen Freunden in Berlin, welch gesunder Lebenswandel mich nun erwartete. Sich outdoor bewegen statt indoor betrinken, erwachsen werden, sich neu erfinden – so stellte ich mir mein Leben in Konstanz vor. Doch nach einigen ziellosen Streifzügen durch die Konstanzer Innenstadt durchfuhr mich ein Rebellionsinstinkt, den ich zuletzt noch im Elternhaus lebend verspürte. Die spießbürgerliche Atmosphäre, die man Konstanz, nachdem man zehnmal die Schönheit des Sees betont hat, zugestehen muss, weckte in mir eine tiefe Sehnsucht nach Alkohol, Marihuana und Farbbomben. Ein Verlangen nach bedingungsloser Unvernunft ergriff mich, ein postpubertäres Trotzverhalten: Selbstdestruktion als Statement – keine altersgemäße Einstellung, keine Frage. In Berlin konnte ich nachts beim Späti um die Ecke auf der Bierbank sitzen bis es Morgen wurde und glitzernde, aufgekratzte Clubgänger auf ihrem Weg zur Afterhour beobachten. Ich hatte die Möglichkeit, ausschweifenden Lebensstil in mich aufsaugen, ohne ihn selbst unbedingt führen zu müssen. Meine liebevoll gebastelten Lebensentwürfe in eine gutbürgerliche, süddeutsche Umgebung zu integrieren, hatte ich nie gelernt.
L: Ich war bereits in Konstanz angekommen – zumindest physisch –, als mich ein ähnliches Rebellionsgefühl überkam. An einem meiner ersten Tage in Konstanz spazierte ich statt am See im Edeka-Center vor den Bierregalen auf und ab. Ich war überfordert von all dem 0,33l-Bier und den vielen Dosen, die mich statt 0,5l-Flaschen aus den Regalen anlachten. Außerdem gab es weder mein innig geliebtes Sternburg Bier noch Berliner Pilsner oder Kindl. Nicht entscheidungsfähig verließ ich den Supermarkt unverrichteter Dinge. Am Abend war ich verabredet und sollte Bier mitbringen. Da der Edeka mittlerweile geschlossen hatte, machte ich mich auf die Suche nach einem Späti (der Spätkauf, liebevoll „Späti“ genannt, sichert den BerlinerInnen 24 Stunden am Tag die Versorgung mit lebenswichtigen Grundnahrungsmitteln sowie Getränken). Die Straßen waren menschenleer und wirkten wie nach einer Evakuierung – ein komatöser Zustand, den ich in Berlin allenfalls vom Sonntagmorgen kenne, an dem die halbe Stadt noch im Club oder Bett steckt. Mir fiel ein, dass es ganz in der Nähe eine Tankstelle gab. Also machte ich mich dorthin auf, um zu erfahren, dass ich um 22.20 Uhr in Konstanz außer in einer Bar kein Bier mehr bekommen würde. Um 22 Uhr sei Verkaufsende für Alkohol. Ich spürte ein merkwürdiges Gefühl in mir aufsteigen. Es erinnerte mich an die Zeit kurz vor meinem 16. Geburtstag, als ich nichts wollte außer Bier kaufen – die unwiderstehliche Verlockung des Verbotenen. Plötzlich wollte ich mich nur noch outdoor betrinken, die sonst so gepflegte Kulisse Konstanz‘ durchbrechen und der Freiheit ein Denkmal in Flaschenform setzen.
Süddeutsche Idylle vs. Berliner Großstadtdschungel
F: Die letzten Jahre in Berlin hatte ich damit verbracht, den eher als biederen Öko-Familienbezirk verschrienen Prenzlauer Berg gegen meine roughen Zeitgenossen aus dem Wedding und Neukölln zu verteidigen. Mir kamen Sätze wie: „Es ist halt einfach angenehm und ein bisschen ruhiger hier“, über die Lippen. In Konstanz angekommen, wurde mir schnell klar, dass Prenzlauer Berg ein ungezähmtes, anarchisches Stück Lebensraum im Vergleich zum baden-württembergischen Idyll ist. Liebevoll angebrachte Schilder am Hörnle wie „Vernünftige Fahrradfahrer steigen hier ab, für alle anderen gilt ein Fahrverbot“ würden sich selbst die sojalattetrinkenden Ökomuttis aus Prenzlauer Berg wohl nicht bieten lassen. Man, beziehungsweise Frau, würde zumindest ein „Fahrradfahrerinnen“ dazuschreiben. Auch der demografische Wandel ist hier in Konstanz durchaus anders zu spüren: Während man in Berlin neben Schießereien der Straßengangs zunehmend auch auf der Hut vor rasenden Kinderwagen sein sollte, gilt es hier, sich vor durch Busse schleudernden Rollatoren zu schützen.
Doch bis man eines Rollators bedarf, hält man sich fit – in Berlin wie in Konstanz. An der Gesundheitsfront säumen in Konstanz statt „Raw-Food“-Restaurants Outdoorläden und – tja, wie nennt man die Läden, in denen man Eiweißpulver in übergroßen farbenfrohen Plastikbehältern kaufen kann? – die Straßen.
Während ich in Berlin fast täglich durch den Park joggte und sogar heimlich in einem Fitnessstudio angemeldet war, flößte mir das sportliche Engagement anfangs hier fast Angst ein. Alle sind so fit und gerne draußen und ich ja eigentlich auch, aber zack – wieder hat mich meine neu aufflammende Postpubertät fest im Griff. Ich will ausschlafen, auch wenn die Sonne scheint, Filme gucken und The Cure hören. Die Zerstörung feiern und die Leute wachrütteln, denn es ist durchaus nicht alles so harmonisch und schön!
L: Alles wirkt aber harmonisch und schön. Im Vergleich zu meinem heruntergekommenen Berlin wie eine andere Welt – eine heile Welt. Damit der Herosé-Park (der, nebenbei bemerkt, in meinen Augen eher ein Ufer ist als ein Park) nicht vollgepinkelt wird, wird ein öffentlicher kostenloser Klowagen aufgestellt, in dem es meistens sogar Klopapier gibt. In Berlin wäre der Wagen innerhalb von ein paar Stunden mit Graffiti und Edding beschmiert und die Kloschüssel wahrscheinlich geklaut. Die Graffitis, die ich in Konstanz gesehen habe, kann ich an einer Hand abzählen. Alle Hauswände strahlen immer noch in der nicht zu aufdringlichen, perfekt zu allen anderen Hauswänden passenden Farbe. Das Gras in den Vorgärten ist überall 2cm hoch. Kleinstadtatmosphäre gekoppelt mit dem Lebensstandard Baden-Württembergs – das Leben in Konstanz ist gut, keine Frage. Dass ein Klowagen nicht direkt demoliert wird, könnte wenn dann wohl eher als ein Schock im Positiven bezeichnet werden. Aber ich komme mir manchmal ein bisschen vor wie in einer Blase. Das Leben ist nicht immer nur Outdoor-Laden oder gemütliches Café. Manchmal ist es auch miefige Kneipe oder zerfallenes Haus, besprayte frisch gestrichene Wand oder Hundekacke auf der Straße.
Ich denke, vielleicht wirkt Konstanz manchmal wie eine Kulisse, weil alles so künstlich aufeinander abgestimmt scheint. Im Herbst war ich öfter mit meinen gelben Gummistiefeln in der Uni. „Voll mutig, dass du solche Schuhe anziehst!”, wurde mir von Menschen, die ich gar nicht kannte, in der Uni-Aula gesagt. Zugegeben, meine gelben Stiefel stechen aus der sonst schwarz-grauen Schuhwelt heraus, sie sind anders. Ist hier alles so gleich, dass es mutig ist, anders zu sein? Ich vermisste plötzlich mein Berlin, in dem die Normalität ist, unnormal zu sein, wo sich niemand dafür interessiert, wenn du im Bademantel U-Bahn fährst – außer vielleicht ein paar Touris aus Baden-Württemberg. In Berlin ist es natürlich unter anderem deshalb egal, wenn ich ungekämmt im Schlafanzug schnell zum Bäcker flitze, weil mir nicht wie in Konstanz möglicherweise mein Professor oder der Typ, auf den ich stehe, an der Kasse begegnen wird. Dass ich meine Kamelhaarflipflops aus Marokko mal als Zeichen der Rebellion anziehe und jeder angeekelte Blick, den ich dafür ernte, eine Genugtuung für mich ist, hätte ich trotzdem nicht gedacht.
Abendprogramm und die Bar vor der Haustür
L: Beim Bierkauf habe ich immer noch die Qual der Wahl. Was mein Abendprogramm angeht, wird sie mir dankbarerweise abgenommen – womit ich auch wieder nicht zufrieden bin. Ich habe mal wieder Lust auf Poetry Slam und schaue nach, ob es in Konstanz einen gibt. Ja, gibt es. Genau einen im Monat nämlich. Ich rolle innerlich etwas genervt mit den Augen und denke, dass es in Berlin allein heute wahrscheinlich drei gegeben hätte. In Berlin richten sich die Veranstaltungen, zu denen ich gehe, nach meinem Kalender. In Konstanz richte ich meinen Kalender nach den Veranstaltungen, die es gibt, nein, hat! Irgendwann fällt mir auf, dass es etwas ironisch ist, dass ich am Ende sowohl in Konstanz als auch in Berlin einmal im Monat zu einem Poetry Slam gehe.
Dieses Muster der ungenutzten Möglichkeiten spiegelt sich in einigen Bereichen wider. In Konstanz treffe ich mich im Sommer mit allen Menschen immer am Seerhein. Das ist eben so ziemlich der einzige schöne Ort, an dem man sich treffen kann. In Berlin treffe ich mich im Sommer mit meinen Leuten immer im selben Park auf derselben Bank. Der Unterschied ist, dass wir sonst wohin gehen könnten, wenn wir wollten. Dort sitzen wir dann zufrieden, weil wir das Gefühl haben, freiwillig hier zu sein und nicht, weil uns der Mangel an Alternativen dazu zwingt. Hauptsache, ich habe das Gefühl, die freie Wahl zu haben. Dazu sei gesagt, dass ich mich mit diesem Problem ziemlich alleine fühle. Ich habe schon oft das Gespräch geführt: „Ich komme aus einem ganz kleinen Dorf, für mich ist Konstanz total die große Stadt, es gibt hier sogar ein Kino!“
F: Manchmal scheint es mir, als hätte Berlin die Qual der Wahl erfunden. Zumindest was Deutschland angeht. Das Wochenende ist längst nicht mehr als Platzhirsch der Veranstaltungen und Partys zu erkennen. Man geht täglich ins Theater, auf Vernissagen, Finissagen, ins Kino, in Bars, in Clubs. Das Überangebot führt nicht selten zu Lethargie. Ich denke an meine Freunde, denen es genauso wie mir nach einer Überdosis Berlin in der Anfangszeit ging. Während uns beim gemütlichen Weinabend zu Hause ein neu zugezogener Israeli mit leuchtenden Augen verkündet, dass hier alles möglich sei, und ob wir denn schon in diesem oder jenem subversiven Theater-Bar-Atelier abgehangen hätten, schlagen wir die Augen nieder und klopfen dem Jüngling großmütterlich auf den Rücken, nach dem Motto: „Ach ja, die jungen Wilden.” Jetzt unterhält man sich über die Reizüberflutung und den Selbstsoptimierungswahn, diese schönen, besonderen und selbstverwirklichten Menschen, denen man auf einem hippen Flohmarkt einfach nicht aus dem Weg gehen kann und die einen an einem strahlenden Sonntag schon einmal deprimieren können. Sie erinnern einen daran, dass man weder bereits vier Startups gegründet noch eine Halstuchstrickaktion für Junkies am Bahnhof Zoo initiiert hat und nicht einmal bahnbrechende originelle Gedanken vorzuweisen hat. Berlin gestattet einem keine Ausrede. Man kann (fast) alles tun, immer.
Konstanz dagegen ist etwas gnädiger. Da gibt es eine Handvoll Bars, die auch nicht immer geöffnet hat, und eine übersichtliche Anzahl an kulturellem Angebot, das liebevoll von der hiesigen Studentenzeitung wöchentlich aufbereitet wird (ein amüsanter Gedanke, eine Berliner Hochschulzeitung würde sich dasselbe vornehmen). Nachdem ich mich einmal, noch in Berlin wohnend, an einem Freitagabend aus schierer Überforderung des Wochenendangebotes in der WG-Küche verbarrikadierte und in einem Wahn der aktiven Entnetzung damit begann, sämtliche Kultur-Newsletter aufzukündigen sowie mein Facebook-Profil zu löschen, schätze ich in Konstanz jedes Konzert und jeden Kinobesuch und genieße ein bisschen das beruhigende Gefühl, dabei nicht unzählige andere Veranstaltungen verpasst zu haben.
Tiefgefrorenes nach der Party und Konstanz‘ erster Späti
L: Was mir hier immer noch seelische Schmerzen bereitet, ist die Misshandlung der deutschen Grammatik. Ich bin die, die aus Berlin kommt, nicht die, wo aus Berlin kommt. Konstanz lässt mich meine Liebe für Relativsätze, wo wirklich toll sind, neu entdecken. Zu vielen anderen Dingen habe ich mittlerweile meinen Zugang gefunden. Sei es, dass ich mir Bier aus Berlin mitbringe oder eben meine Kamelhaarflipflops anziehe. Dass hier beim Kochen einfach immer Mehl und Eier vermischt und daraus unterschiedliche Formen gemacht werden, damit es jedes Mal ein anderes Gericht ist – Spätzle, Knöpfle, Flädle oder Kratzete –, habe ich mittlerweile gelernt und besorge mir bei meinem Wocheneinkauf nur noch diese beiden Zutaten. Für eine abwechslungsreiche Ernährung in ihrer einfachsten Form. Davon friere ich auch immer noch etwas ein. Wenn man nämlich abends von der Party nach Hause kommt und nichts im Kühlschrank hat, muss man in Konstanz anders als in Berlin leider verhungern.
Bei vielen Gesprächen kann ich dennoch nicht mitreden. Nicht nur, weil ich den Dialekt nicht verstehe, sondern auch, weil ich viele Gemeinsamkeiten, die alle in einer baden-württembergischen Kleinstadt oder einem Dorf Aufgewachsenen haben, nicht teile, wie das Schulsystem oder das typische Essen, das es zuhause immer gab. Die verbindenden „Haha, ja, bei mir war das genauso!“-Momente fehlen mir hier einfach, bis ich sie dann mit Fiona habe. Jetzt essen wir gemeinsam Spätzle statt Currywurst und beraten über einen geeigneten Standort für den ersten Späti in Konstanz, den wir eröffnen werden.